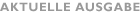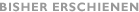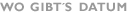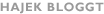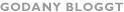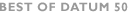Baumeister des Faschismus
Antisemit, Hetzer gegen die Demokratie, Mitglied paramilitärischer Vereinigungen:
Stationen im Leben von Julius Raab in den Jahren vor dem Nationalsozialismus. Lehrjahre eines österreichischen Staatsvertragskanzlers.
Text: Klemens Kaps
Im Nationalrat war die Stimmung angespannt. „Ein Frechling sind Sie, ein Saujud!“, schrie Julius Raab erbost quer durch den Plenarsaal zu Otto Bauer hinüber. „Der Raab applaudiert, die Heimwehr ist zufrieden“, hatte der Chef der sozialdemokratischen Arbeiterpartei kurz zuvor süffisant bemerkt – und sich damit den Zorn des niederösterreichischen Heimwehrführers eingehandelt.
Angegriffen war das Nervenkostüms des gelernten Baumeisters an jenem 11. Juli 1930 allemal: Nur zwei Tage waren es noch bis zur Abstimmung über ein neues Waffengesetz, das die paramilitärischen Gruppen, zu denen auch die rechtsgerichtete Heimwehr gehörte, eindämmen sollte. Und wieder einmal saß Julius Raab als christlichsozialer Abgeordneter und Heimwehrmann zwischen allen Stühlen. Schlussendlich hielt er aber den faschistischen Wehrverbänden die Treue: Die neue Waffen-Regelung wurde gegen Raabs Stimme Gesetz.

Anfang der Dreißigerjahre hielten politischen Grabenkämpfe das Land gefangen: Seit zehn Jahren regierte auf Bundesebene eine Koalition der bürgerlich-rechten Parteien, während in den Städten die Sozialdemokraten den Ton angaben. Aggressiver Antimarxismus auf der Rechten und totaler Machtanspruch auf der Linken verhinderten eine Neuauflage der Großen Koalition der unmittelbaren Nachkriegsjahre.
Die Wehrverbände, die sich die Parteien hielten, drehten die Spirale der Eskalation täglich ein Stück weiter. In diesem Treiben war Julius Raab, 1891 als Sohn einer angesehenen Unternehmerfamilie in St. Pölten geboren, mittendrin statt nur dabei. Der Studienabbrecher war in den Nachkriegsjahren zu den niederösterreichischen Christlichsozialen gestoßen und machte erstmals im Lagerwahlkampf 1927 als antimarxistischer Scharfmacher auf sich aufmerksam. „Moderne Janitscharentruppen, geführt von der Peitsche volksfremder Parteidiktatoren, stürmen gegen die Ostmark. St. Georg am 24. April soll Helfer sein, dass das österreichische Volk Mut und Kraft erhalte, dem Drachen des roten Bolschewismus aufs Haupt zu schlagen zum Heile Österreichs“, hetzte Raab am 21. April 1927 in der St. Pöltner Zeitung gegen die Sozialdemokraten.
Als nur wenige Monate später, am 15. Juli, Demonstranten den Wiener Justizpalast in Flammen aufgehen ließen und Bundeskanzler Ignaz Seipel eine Allianz mit den Heimwehren schloss, schlug auch für den jungen Nationalratsabgeordneten eine neue Stunde: Um die von Mussolinis Italien eifrig unterstützte Miliz den Christlichsozialen gefügig zu machen, musste Raab in sein Stammland Niederösterreich zurückkehren – diesmal zum Aufbau einer verlässlichen Heimwehrorganisation.
„Wir wollen den Schutz des Heimatbodens, den Schutz von Haus und Hof. Solange ein 15. Juli in Wien möglich ist, so lange darf die bodenständige christliche Bevölkerung nicht ungerüstet und wehrlos bleiben“, fasste Raab am 17. August 1928 in der Zeitschrift Die Heimwehr seine Ziele zusammen. Doch ging es dem ehemaligen Weltkriegsoffizier nicht um bloße Defensivpolitik. Provokationen waren angesagt. Nur wenige Wochen nach seiner Wahl zum niederösterreichischen Landesführer kam es am 7. Oktober 1928 in Wiener Neustadt beinahe zu einem gewaltsamen Zusammenstoß: Raab marschierte mit seiner Heimwehr in der roten Bastion auf.
Es galt, den Sozis die Straße streitig zu machen, die sie mit ihrer Wehrorganisation, dem Republikanischen Schutzbund, in den Städten beherrschten. Raabs bis dahin ungesehenes Manöver rief sogleich die roten Paramilitärs auf den Plan. Bundesheer und Gendamerie mussten sich zwischen die Streithähne werfen, um ein Blutvergießen zu verhindern. Das Klima polarisierte sich rasch – und Raab war einer der Antreiber. „Die Hetzer, die die Arbeiter von Wien zur blutigen Revolte aufpeitschten, sind volksfremde jüdische Demagogen. Wesensfremd und volksfremd ist dieser Gegner, undeutsch ist seine Art, Zerstörung und Vernichtung ist sein Programm. Als es den Sozialdemokraten in den ersten Jahren dieser Republik nicht gelungen war, die Macht im Staat zu erreichen, suchen sie nunmehr auf anderen Wegen die Majorität zu erreichen und damit die Bahn für die sozialistische Republik oder besser gesagt für die jüdische Diktatur freizubekommen. Die Heimwehr nimmt jeden auf, der mithelfen will, Österreich, unser schönes deutsches Vaterland von dem Joche, das volksfremde jüdische Führer errichtet haben, zu befreien“, wetterte er am 6. Jänner 1929 in einer Rede beim Dreikönigstreffen der niederösterreichischen Heimwehr in Tulln, welche Die Heimwehr in ihrer Ausgabe vom 11. Jänner abdruckte. Der tiefkatholische Raab wurde zunehmend deutschnational – und antisemitischer.
Judenhass hatte bei den Christlichsozialen seit jeher einen guten Nährboden vorgefunden. Die erste Galionsfigur der katholischen Partei, der Wiener Bürgermeister Karl Lueger, avancierte in der untergehenden Monarchie zum ersten modernen Antisemiten Österreichs. Und die Republik war noch keine zwei Jahre alt, als der christlichsoziale Arbeiterführer Leopold Kunschak im Parlament unverblümt forderte, dass Juden „unverzüglich in Konzentrationslager“ zu internieren seien. Julius Raab, Absolvent des Stiftsgymnasiums Seitenstetten, war im Milieu des politischen Katholizismus groß geworden. Als er im Oktober 1911 an der Technischen Hochschule in Wien sein Studium aufnahm, trat er unverzüglich der katholischen Studentenverbindung Norica bei, einer der zahlreichen Untergruppierungen des Österreichischen Cartellverbands (ÖCV). Dieser fungierte seit der Jahrhundertwende als Dachverband für alle katholischen Studentenverbindungen, in denen der Antisemitismus rasch Fuß fasste.
Als Julius Raab als „Senior“ der Norica kurz nach Kriegsende 1919 die bislang verfeindeten katholischen und deutschnationalen Burschenschaften miteinander aussöhnte, wollten die elitären Jung-Herrenclubs damit den gemeinsamen Kampf gegen jüdische und sozialistische Studenten an Österreichs Universitäten forcieren.
Diese Allianz prägte Raabs Politik. Während er Sozialdemokraten („Die rote Pest“) und Juden – die er immer mit den Sozis in einem Boot wähnte – scharf angriff, zeigte sich der Mann, der sich unter dem NS-Regime von jeglichem Widerstand fern hielt, nach rechts hin sehr offen: Nicht nur sah Raab im Nationalsozialismus lange Zeit keine Gefahr, auch in der Heimwehrbewegung grenzte er sich nur zaghaft von den faschistischen Strömungen ab.
Immer öfter forderten die Führer der Paramilitärs in den späten Zwanzigern unverhohlen die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie. „Heimwehrleute von Niederösterreich! Ihr könnt den Kampf siegreich nur bestehen, wenn ihr einig und geschlossen auftretet. Handelt ihr so, so wird erst die wahre Demokratie an Stelle der jetzigen Scheindemokratie aufgerichtet werden“, hatte auch Raab am 24. November 1928 in Die Heimwehr propagiert. Fast ein Jahr und eine Verfassungsreform später beteuerte derselbige am 23. Oktober 1929 im Nationalrat: „Wir wollen diese Organisation nicht zu irgendeinem Putsch führen“ – und hob im selben Atemzug zu einer Drohung an: „Aber wir wissen, dass die Bestrebungen, die im Volk bestehen, vielleicht zu unvernünftigen Taten führen, wenn dieses Parlament hier nicht seine Pflicht erfüllt. Wir, die wir in der Heimatwehr stehen, wissen, dass diese Regierung mit dieser Verfassungsreform den ersten Schritt getan hat, um Österreich zur wirklichen Demokratie zu führen.“
Raab vollführte in dieser Zeit einen Balanceakt. Wollte er weiterhin den Auftrag seines Mentors Seipel ausführen, so musste er ein Stück des faschistischen Weges mitgehen. Doch zugleich gefährdeten gerade die diktatorischen Gelüste der Hahnenschwänzler Raabs Partei selbst. Am 18. Mai 1930 setzte der Bundesführer der Heimwehren, der christlichsoziale Bundesrat Richard Steidle, seinen Parteifreund unter Zugzwang. Im niederösterreichischen Korneuburg sollte sich Raab entscheiden. „Wollen Sie wie bisher auf dem Standpunkt stehen, dass die Heimwehr nichts ist als der Eintreiber der Parteien, oder wollen Sie sich für das faschistische System erklären?“, fragte ihn Steidle und las sodann den Text vor, der als „Korneuburger Eid“ in die Geschichte eingehen sollte: „Wir wollen den Volksstaat des Heimatschutzes! Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat! Wir kämpfen gegen die Zersetzung unseres Volkes durch den marxistischen Klassenkampf und liberal-kapitalistische Wirtschaftsgestaltung.“
Der überrumpelte Raab zögerte keine Sekunde: „Ich erkläre auch heute, mit den Zielen der Bundesführung einverstanden zu sein“, meinte er laut der Wiener Zeitung vom 20. Mai 1930 und reichte Steidle seine Hand zum Gelöbnis.
„Der Faschismus reinsten Wassers hat also auch in der niederösterreichischen Heimwehr gesiegt“, kommentierte die Arbeiterzeitung tags darauf Raabs Schwur trocken, während der christlichsoziale Arbeiterführer Leopold Kunschak nur schwer sein Entsetzen über die Geschehnisse von Korneuburg verbergen konnte: „Wie weit unterscheidet sich das noch vom Bolschewismus? Nur noch durch die Farbe; die einen rot, die anderen grün-weiß.“ Julius Raab hingegen fühlte sich wohl in einer Heimwehr, welche gegen die Sozialdemokraten Front machte, antisemitisch war und ein faschistisches System anpeilte.
Seine Grenze war allerdings dort erreicht, wo es gegen seine eigene Partei ging. Als sich die neue Heimwehrführung unter Ernst Rüdiger Graf Starhemberg im Herbst 1930 entschloss, mit einer eigenen Liste in die anstehenden Nationalratswahlen zu ziehen, stieg der christlichsoziale Abgeordnete auf die Notbremse. „Ich bin als Christlichsozialer in die Heimwehr gegangen und habe mich mit meiner Weltanschauung nie hinter dem Berg gehalten“, erklärte er am 26. Oktober 1930 auf einer Rede in Amstetten.
Nach einer nervenaufreibenden Zerreißprobe verließ Raab im Dezember 1930 die Heimwehr. Als ein knappes Jahr später, in der Nacht vom 12. auf den 13. September 1931, der steirische Heimwehrführer Walter Pfrimer zum Heimwehr-Putsch blies, stellte sich der nunmehrige Gewerbelobbyist ihm mit aller Gewalt entgegen.
An jenem Tag ergriff Raab noch einmal für die Demokratie Partei – für jene „Scheindemokratie“ also, die er als Heimwehrführer noch vehement bekämpft hatte.
„Unser ganzes Streben und all unsere Arbeit muss darauf gerichtet sein, die Verfassung so zu ändern, dass den berufenen Vertretern des Volkes die Möglichkeit geboten ist, wirklich Arbeit für Volk und Vaterland zu leisten“, äußerte Raab in der St. Pöltner Zeitung vom 2. März 1933 seine Träume von einem „Ständestaat“.
Nur einen Tag später legte sich der Nationalrat selbst lahm. Als Engelbert Dollfuß, der Bundeskanzler aus Niederösterreich, diese Krise prompt ausnutzte und die schwächelnde Demokratie aus ihren Angeln hob, fiel es Raab nicht schwer, ihm zu folgen. Während einige von Raabs Cartellbrüdern, wie der oberösterreichische Landeshauptmann Josef Schlesinger oder Sozialminister Josef Resch, das diktatorische Experiment zunächst skeptisch beäugten, schlug sich Raab sofort auf Dollfuß’ Seite.
„Wir bekennen uns mit voller Überzeugung zur Regierung Dollfuß, die mit fester Hand die Zügel des Staates ergriffen und versprochen hat, dem Handels- und Gewerbestand das zurückzugeben, was ihm genommen wurde“, erklärte er am 8. Jänner 1934 laut St. Pöltner Zeitung bei einer Rede vor dem Reichsgewerbebund, dessen interimistischer Vorsitzender er war. Der Klassenkampf, um den sich Raab zeitlebens so sorgte, war damit in Richtung der Arbeitnehmer eröffnet.
Und auch wenn er eine gewisse Distanz zum Regime wahrte – der ehemalige Heimwehrführer mit den starken Worten werkte am Aufbau der katholischen Diktatur ohne Probleme weiter mit, als schon Dutzende Bürgerkriegstote zu beklagen und tausende politische Gegner in die Gefängnisse des Regimes gewandert waren.
Als am 30. April 1934 der Nationalrat ein letztes Mal einberufen wurde, war Raab einer jener 76 Abgeordneten, die im Eilverfahren die Notverordnungen der Regierung absegneten. Der Weg für die autoritäre Maiverfassung war geebnet.
„Wir wollen den sozialen, christlichen, deutschen Staat Österreich unter starker autoritärer Führung“, hatte Dollfuß am 11. September 1933 auf dem Wiener Trabrennplatz erklärt. Diesem Staat, der mit Benito Mussolinis Italien paktierte und sich einer faschistischen Symbolik und Organisationsweise verschrieb, verdankte der spätere Staatsvertragskanzler Julius Raab seine ersten wirklichen Karrieresprünge in der Politik.
Aus dem einfachen Nationalratsabgeordneten und ehemaligen Paramilitär wurde der stellvertretende Vorsitzende des Bundeswirtschaftsrats – eines der „Stände“, die fortan die verschiedenen „Berufsklassen“ der Gesellschaft repräsentieren sollten. Aussöhnung der gegenseitigen Interessen, Harmonie statt Klassenkampf lautete die offizielle Parole. „Die Arbeiter müssen aus den Klauen der marxistischen Verführer befreit werden und der Volksgemeinschaft wieder zugeführt werden“, hatte Raab bereits am 9. November 1928 in in der Heimwehr gefordert.
Der Ständestaat pendelte fortan zwischen christlich-konservativem Kulturkampf und Faschismus – und Julius Raab erging es nicht anders. Als Abgeordneter zum Bundestag, dem beratenden Gremium der Regierung, gehörte Raab lange zum erweiterten Führungskreis des neuen Regimes, bevor er am 16. Februar 1938 direkt in die Machtzentrale aufstieg: Bundeskanzler Kurt Schuschnigg ernannte ihn zum Handelsminister. Sein Pech: Den Posten musste der Baumeister aus der Provinz schon nach einem knappen Monat wieder räumen. Rot-Weiss-Rot kapitulierte widerstandslos vor dem Hakenkreuz.
Als aus den Trümmern des Nationalsozialismus die Zweite Republik entstand, stieg auch Julius Raab wieder wie der Phönix aus der Asche auf: Das Bild des glühenden Antisemiten von einst, der mit faschistisch-autoritären Experimenten geliebäugelt hatte, wich bis heute jenem des allseits gefeierten Staatsvertragskanzlers.
Angegriffen war das Nervenkostüms des gelernten Baumeisters an jenem 11. Juli 1930 allemal: Nur zwei Tage waren es noch bis zur Abstimmung über ein neues Waffengesetz, das die paramilitärischen Gruppen, zu denen auch die rechtsgerichtete Heimwehr gehörte, eindämmen sollte. Und wieder einmal saß Julius Raab als christlichsozialer Abgeordneter und Heimwehrmann zwischen allen Stühlen. Schlussendlich hielt er aber den faschistischen Wehrverbänden die Treue: Die neue Waffen-Regelung wurde gegen Raabs Stimme Gesetz.

Anfang der Dreißigerjahre hielten politischen Grabenkämpfe das Land gefangen: Seit zehn Jahren regierte auf Bundesebene eine Koalition der bürgerlich-rechten Parteien, während in den Städten die Sozialdemokraten den Ton angaben. Aggressiver Antimarxismus auf der Rechten und totaler Machtanspruch auf der Linken verhinderten eine Neuauflage der Großen Koalition der unmittelbaren Nachkriegsjahre.
Die Wehrverbände, die sich die Parteien hielten, drehten die Spirale der Eskalation täglich ein Stück weiter. In diesem Treiben war Julius Raab, 1891 als Sohn einer angesehenen Unternehmerfamilie in St. Pölten geboren, mittendrin statt nur dabei. Der Studienabbrecher war in den Nachkriegsjahren zu den niederösterreichischen Christlichsozialen gestoßen und machte erstmals im Lagerwahlkampf 1927 als antimarxistischer Scharfmacher auf sich aufmerksam. „Moderne Janitscharentruppen, geführt von der Peitsche volksfremder Parteidiktatoren, stürmen gegen die Ostmark. St. Georg am 24. April soll Helfer sein, dass das österreichische Volk Mut und Kraft erhalte, dem Drachen des roten Bolschewismus aufs Haupt zu schlagen zum Heile Österreichs“, hetzte Raab am 21. April 1927 in der St. Pöltner Zeitung gegen die Sozialdemokraten.
Als nur wenige Monate später, am 15. Juli, Demonstranten den Wiener Justizpalast in Flammen aufgehen ließen und Bundeskanzler Ignaz Seipel eine Allianz mit den Heimwehren schloss, schlug auch für den jungen Nationalratsabgeordneten eine neue Stunde: Um die von Mussolinis Italien eifrig unterstützte Miliz den Christlichsozialen gefügig zu machen, musste Raab in sein Stammland Niederösterreich zurückkehren – diesmal zum Aufbau einer verlässlichen Heimwehrorganisation.
„Wir wollen den Schutz des Heimatbodens, den Schutz von Haus und Hof. Solange ein 15. Juli in Wien möglich ist, so lange darf die bodenständige christliche Bevölkerung nicht ungerüstet und wehrlos bleiben“, fasste Raab am 17. August 1928 in der Zeitschrift Die Heimwehr seine Ziele zusammen. Doch ging es dem ehemaligen Weltkriegsoffizier nicht um bloße Defensivpolitik. Provokationen waren angesagt. Nur wenige Wochen nach seiner Wahl zum niederösterreichischen Landesführer kam es am 7. Oktober 1928 in Wiener Neustadt beinahe zu einem gewaltsamen Zusammenstoß: Raab marschierte mit seiner Heimwehr in der roten Bastion auf.
Es galt, den Sozis die Straße streitig zu machen, die sie mit ihrer Wehrorganisation, dem Republikanischen Schutzbund, in den Städten beherrschten. Raabs bis dahin ungesehenes Manöver rief sogleich die roten Paramilitärs auf den Plan. Bundesheer und Gendamerie mussten sich zwischen die Streithähne werfen, um ein Blutvergießen zu verhindern. Das Klima polarisierte sich rasch – und Raab war einer der Antreiber. „Die Hetzer, die die Arbeiter von Wien zur blutigen Revolte aufpeitschten, sind volksfremde jüdische Demagogen. Wesensfremd und volksfremd ist dieser Gegner, undeutsch ist seine Art, Zerstörung und Vernichtung ist sein Programm. Als es den Sozialdemokraten in den ersten Jahren dieser Republik nicht gelungen war, die Macht im Staat zu erreichen, suchen sie nunmehr auf anderen Wegen die Majorität zu erreichen und damit die Bahn für die sozialistische Republik oder besser gesagt für die jüdische Diktatur freizubekommen. Die Heimwehr nimmt jeden auf, der mithelfen will, Österreich, unser schönes deutsches Vaterland von dem Joche, das volksfremde jüdische Führer errichtet haben, zu befreien“, wetterte er am 6. Jänner 1929 in einer Rede beim Dreikönigstreffen der niederösterreichischen Heimwehr in Tulln, welche Die Heimwehr in ihrer Ausgabe vom 11. Jänner abdruckte. Der tiefkatholische Raab wurde zunehmend deutschnational – und antisemitischer.
Judenhass hatte bei den Christlichsozialen seit jeher einen guten Nährboden vorgefunden. Die erste Galionsfigur der katholischen Partei, der Wiener Bürgermeister Karl Lueger, avancierte in der untergehenden Monarchie zum ersten modernen Antisemiten Österreichs. Und die Republik war noch keine zwei Jahre alt, als der christlichsoziale Arbeiterführer Leopold Kunschak im Parlament unverblümt forderte, dass Juden „unverzüglich in Konzentrationslager“ zu internieren seien. Julius Raab, Absolvent des Stiftsgymnasiums Seitenstetten, war im Milieu des politischen Katholizismus groß geworden. Als er im Oktober 1911 an der Technischen Hochschule in Wien sein Studium aufnahm, trat er unverzüglich der katholischen Studentenverbindung Norica bei, einer der zahlreichen Untergruppierungen des Österreichischen Cartellverbands (ÖCV). Dieser fungierte seit der Jahrhundertwende als Dachverband für alle katholischen Studentenverbindungen, in denen der Antisemitismus rasch Fuß fasste.
Als Julius Raab als „Senior“ der Norica kurz nach Kriegsende 1919 die bislang verfeindeten katholischen und deutschnationalen Burschenschaften miteinander aussöhnte, wollten die elitären Jung-Herrenclubs damit den gemeinsamen Kampf gegen jüdische und sozialistische Studenten an Österreichs Universitäten forcieren.
Diese Allianz prägte Raabs Politik. Während er Sozialdemokraten („Die rote Pest“) und Juden – die er immer mit den Sozis in einem Boot wähnte – scharf angriff, zeigte sich der Mann, der sich unter dem NS-Regime von jeglichem Widerstand fern hielt, nach rechts hin sehr offen: Nicht nur sah Raab im Nationalsozialismus lange Zeit keine Gefahr, auch in der Heimwehrbewegung grenzte er sich nur zaghaft von den faschistischen Strömungen ab.
Immer öfter forderten die Führer der Paramilitärs in den späten Zwanzigern unverhohlen die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie. „Heimwehrleute von Niederösterreich! Ihr könnt den Kampf siegreich nur bestehen, wenn ihr einig und geschlossen auftretet. Handelt ihr so, so wird erst die wahre Demokratie an Stelle der jetzigen Scheindemokratie aufgerichtet werden“, hatte auch Raab am 24. November 1928 in Die Heimwehr propagiert. Fast ein Jahr und eine Verfassungsreform später beteuerte derselbige am 23. Oktober 1929 im Nationalrat: „Wir wollen diese Organisation nicht zu irgendeinem Putsch führen“ – und hob im selben Atemzug zu einer Drohung an: „Aber wir wissen, dass die Bestrebungen, die im Volk bestehen, vielleicht zu unvernünftigen Taten führen, wenn dieses Parlament hier nicht seine Pflicht erfüllt. Wir, die wir in der Heimatwehr stehen, wissen, dass diese Regierung mit dieser Verfassungsreform den ersten Schritt getan hat, um Österreich zur wirklichen Demokratie zu führen.“
Raab vollführte in dieser Zeit einen Balanceakt. Wollte er weiterhin den Auftrag seines Mentors Seipel ausführen, so musste er ein Stück des faschistischen Weges mitgehen. Doch zugleich gefährdeten gerade die diktatorischen Gelüste der Hahnenschwänzler Raabs Partei selbst. Am 18. Mai 1930 setzte der Bundesführer der Heimwehren, der christlichsoziale Bundesrat Richard Steidle, seinen Parteifreund unter Zugzwang. Im niederösterreichischen Korneuburg sollte sich Raab entscheiden. „Wollen Sie wie bisher auf dem Standpunkt stehen, dass die Heimwehr nichts ist als der Eintreiber der Parteien, oder wollen Sie sich für das faschistische System erklären?“, fragte ihn Steidle und las sodann den Text vor, der als „Korneuburger Eid“ in die Geschichte eingehen sollte: „Wir wollen den Volksstaat des Heimatschutzes! Wir verwerfen den westlichen demokratischen Parlamentarismus und den Parteienstaat! Wir kämpfen gegen die Zersetzung unseres Volkes durch den marxistischen Klassenkampf und liberal-kapitalistische Wirtschaftsgestaltung.“
Der überrumpelte Raab zögerte keine Sekunde: „Ich erkläre auch heute, mit den Zielen der Bundesführung einverstanden zu sein“, meinte er laut der Wiener Zeitung vom 20. Mai 1930 und reichte Steidle seine Hand zum Gelöbnis.
„Der Faschismus reinsten Wassers hat also auch in der niederösterreichischen Heimwehr gesiegt“, kommentierte die Arbeiterzeitung tags darauf Raabs Schwur trocken, während der christlichsoziale Arbeiterführer Leopold Kunschak nur schwer sein Entsetzen über die Geschehnisse von Korneuburg verbergen konnte: „Wie weit unterscheidet sich das noch vom Bolschewismus? Nur noch durch die Farbe; die einen rot, die anderen grün-weiß.“ Julius Raab hingegen fühlte sich wohl in einer Heimwehr, welche gegen die Sozialdemokraten Front machte, antisemitisch war und ein faschistisches System anpeilte.
Seine Grenze war allerdings dort erreicht, wo es gegen seine eigene Partei ging. Als sich die neue Heimwehrführung unter Ernst Rüdiger Graf Starhemberg im Herbst 1930 entschloss, mit einer eigenen Liste in die anstehenden Nationalratswahlen zu ziehen, stieg der christlichsoziale Abgeordnete auf die Notbremse. „Ich bin als Christlichsozialer in die Heimwehr gegangen und habe mich mit meiner Weltanschauung nie hinter dem Berg gehalten“, erklärte er am 26. Oktober 1930 auf einer Rede in Amstetten.
Nach einer nervenaufreibenden Zerreißprobe verließ Raab im Dezember 1930 die Heimwehr. Als ein knappes Jahr später, in der Nacht vom 12. auf den 13. September 1931, der steirische Heimwehrführer Walter Pfrimer zum Heimwehr-Putsch blies, stellte sich der nunmehrige Gewerbelobbyist ihm mit aller Gewalt entgegen.
An jenem Tag ergriff Raab noch einmal für die Demokratie Partei – für jene „Scheindemokratie“ also, die er als Heimwehrführer noch vehement bekämpft hatte.
„Unser ganzes Streben und all unsere Arbeit muss darauf gerichtet sein, die Verfassung so zu ändern, dass den berufenen Vertretern des Volkes die Möglichkeit geboten ist, wirklich Arbeit für Volk und Vaterland zu leisten“, äußerte Raab in der St. Pöltner Zeitung vom 2. März 1933 seine Träume von einem „Ständestaat“.
Nur einen Tag später legte sich der Nationalrat selbst lahm. Als Engelbert Dollfuß, der Bundeskanzler aus Niederösterreich, diese Krise prompt ausnutzte und die schwächelnde Demokratie aus ihren Angeln hob, fiel es Raab nicht schwer, ihm zu folgen. Während einige von Raabs Cartellbrüdern, wie der oberösterreichische Landeshauptmann Josef Schlesinger oder Sozialminister Josef Resch, das diktatorische Experiment zunächst skeptisch beäugten, schlug sich Raab sofort auf Dollfuß’ Seite.
„Wir bekennen uns mit voller Überzeugung zur Regierung Dollfuß, die mit fester Hand die Zügel des Staates ergriffen und versprochen hat, dem Handels- und Gewerbestand das zurückzugeben, was ihm genommen wurde“, erklärte er am 8. Jänner 1934 laut St. Pöltner Zeitung bei einer Rede vor dem Reichsgewerbebund, dessen interimistischer Vorsitzender er war. Der Klassenkampf, um den sich Raab zeitlebens so sorgte, war damit in Richtung der Arbeitnehmer eröffnet.
Und auch wenn er eine gewisse Distanz zum Regime wahrte – der ehemalige Heimwehrführer mit den starken Worten werkte am Aufbau der katholischen Diktatur ohne Probleme weiter mit, als schon Dutzende Bürgerkriegstote zu beklagen und tausende politische Gegner in die Gefängnisse des Regimes gewandert waren.
Als am 30. April 1934 der Nationalrat ein letztes Mal einberufen wurde, war Raab einer jener 76 Abgeordneten, die im Eilverfahren die Notverordnungen der Regierung absegneten. Der Weg für die autoritäre Maiverfassung war geebnet.
„Wir wollen den sozialen, christlichen, deutschen Staat Österreich unter starker autoritärer Führung“, hatte Dollfuß am 11. September 1933 auf dem Wiener Trabrennplatz erklärt. Diesem Staat, der mit Benito Mussolinis Italien paktierte und sich einer faschistischen Symbolik und Organisationsweise verschrieb, verdankte der spätere Staatsvertragskanzler Julius Raab seine ersten wirklichen Karrieresprünge in der Politik.
Aus dem einfachen Nationalratsabgeordneten und ehemaligen Paramilitär wurde der stellvertretende Vorsitzende des Bundeswirtschaftsrats – eines der „Stände“, die fortan die verschiedenen „Berufsklassen“ der Gesellschaft repräsentieren sollten. Aussöhnung der gegenseitigen Interessen, Harmonie statt Klassenkampf lautete die offizielle Parole. „Die Arbeiter müssen aus den Klauen der marxistischen Verführer befreit werden und der Volksgemeinschaft wieder zugeführt werden“, hatte Raab bereits am 9. November 1928 in in der Heimwehr gefordert.
Der Ständestaat pendelte fortan zwischen christlich-konservativem Kulturkampf und Faschismus – und Julius Raab erging es nicht anders. Als Abgeordneter zum Bundestag, dem beratenden Gremium der Regierung, gehörte Raab lange zum erweiterten Führungskreis des neuen Regimes, bevor er am 16. Februar 1938 direkt in die Machtzentrale aufstieg: Bundeskanzler Kurt Schuschnigg ernannte ihn zum Handelsminister. Sein Pech: Den Posten musste der Baumeister aus der Provinz schon nach einem knappen Monat wieder räumen. Rot-Weiss-Rot kapitulierte widerstandslos vor dem Hakenkreuz.
Als aus den Trümmern des Nationalsozialismus die Zweite Republik entstand, stieg auch Julius Raab wieder wie der Phönix aus der Asche auf: Das Bild des glühenden Antisemiten von einst, der mit faschistisch-autoritären Experimenten geliebäugelt hatte, wich bis heute jenem des allseits gefeierten Staatsvertragskanzlers.
0 Kommentare - Kommentar verfassen -